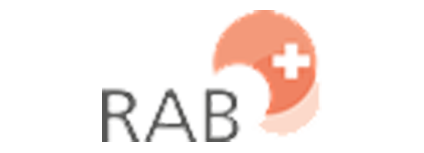Am 28. September 2025 hat das Schweizer Stimmvolk mit deutlicher Mehrheit die Reform der Wohneigentumsbesteuerung angenommen. Damit werden grundlegende Änderungen im Steuerrecht für Wohneigentümer eingeführt.
Kernelemente der Reform
- Abschaffung des Eigenmietwerts
- Wegfall von Abzugsmöglichkeiten
- Private Schuldzinsen sind nur noch begrenzt abzugsfähig
- Kantone können eine Liegenschaftssteuer für Zweitwohnungen einführen
Wegfall von Abzugsmöglichkeiten:
Unterhalts- und Instandstellungskosten, Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen, Rückbaukosten und Versicherungsprämien sind nicht mehr abzugsfähig. Ausgenommen bleiben denkmalpflegerische Arbeiten sowie Verwaltungskosten durch Dritte (abhängig vom Kanton).
Schuldzinsen
Nach der Abschaffung des Eigenmietwerts gilt grundsätzlich: Private Schuldzinsen sind nicht mehr abzugsfähig.
Es gibt aber drei Ausnahmen, die ausdrücklich vorgesehen sind:
- Vermietete Liegenschaften
- Schuldzinsen für Hypotheken können anteilig weiterhin abgezogen werden, soweit sie auf vermietete Objekte entfallen. Entscheidend ist dabei das Verhältnis zwischen vermieteten Liegenschaften und dem gesamten Vermögen (sog. quotal-restriktive Methode). Aus dieser Quote wird die Höhe des künftigen Schuldzinsenabzugs bestimmt. Beispiel: Ein Mehrfamilienhaus, in dem eine Wohnung selbst bewohnt und die anderen vermietet werden → Abzug im Verhältnis der vermieteten Einheiten bleibt möglich.
- Befristeter Ersterwerberabzug
- Beim erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum darf im ersten Jahr bis max. CHF 10’000 (Ehepaare) bzw. CHF 5’000 (Alleinstehende) an Schuldzinsen abgezogen werden. Danach reduziert sich dieser Abzug jedes Jahr um 10 % und fällt nach 10 Jahren ganz weg.
- Unternehmensvermögen
- Schuldzinsen, die betrieblich oder für ein Anlageobjekt anfallen, bleiben steuerlich abziehbar (wie bisher).
Handlungsempfehlungen für Eigentümer
- Sanierungen vorziehen: Absehbare Renovationen sollten noch während der Übergangsphase erfolgen, um steuerliche Vorteile zu sichern.
- Hypothekenstrategie überprüfen: Nicht übermässig amortisieren, sondern Belehnungsquote moderat halten und Diversifikation durch Finanzanlagen prüfen.
- Rechtsform prüfen: In Einzelfällen könnte die Übertragung von Immobilien in eine Kapitalgesellschaft interessant sein, meist aber mit hohen Zusatzkosten verbunden.
- Steuerplanung frühzeitig anpassen: Je nach Kanton variieren die Regelungen zu Abzügen und Objektsteuern, weshalb eine individuelle Analyse sinnvoll ist.
Übergangsphase bis mindestens 2028
Obwohl das Volk die Abschaffung beschlossen hat, bleibt der Eigenmietwert vorerst bestehen. Frühestens ab 2028 entfällt er vollständig. Eigentümer müssen bis dahin weiterhin den fiktiven Mietertrag versteuern. Hintergrund: Der Bund will den Kantonen Zeit geben, eine Objektsteuer für Zweitwohnungen einzuführen, um Steuerausfälle in Tourismusregionen abzufedern.
Kanton Zürich – Stopp der geplanten Erhöhung
Im Kanton Zürich wäre ab 2026 eine Erhöhung des Eigenmietwerts um rund 10 % vorgesehen gewesen, dazu eine Anhebung der Vermögenssteuerwerte um durchschnittlich 48 %. Finanzdirektor Ernst Stöcker hat jedoch nach dem Volksentscheid angekündigt, auf die Erhöhung des Eigenmietwerts während der Übergangsphase zu verzichten. Die höheren Vermögenssteuerwerte sollen dagegen bestehen bleiben – ausser das Bundesgericht gibt einer Beschwerde des Hauseigentümerverbands recht. Neubauten ab 2026 sollen nach neuen Berechnungsmethoden erfasst werden, wobei ‘angemessene Abzüge’ vorgesehen sind, deren konkrete Ausgestaltung noch offen ist.
Politische Diskussion zu neuen Abzugsmöglichkeiten
Obwohl die Reform eigentlich alle Abzüge streicht, erwägen verschiedene Kantone, bei Energiesanierungen oder klimarelevanten Investitionen eigene Steuerabzüge einzuführen. In Zürich zeigen sich insbesondere SVP, FDP und GLP offen für solche Regelungen, während linke Parteien und EVP zurückhaltender bis ablehnend reagieren. Es ist daher möglich, dass trotz Systemwechsel einzelne Abzugsmöglichkeiten wieder eingeführt werden.
Fazit
Eine frühzeitige Planung bezüglich Sanierungen, Finanzierungsstrategie und kantonaler Steuerpraxis ist entscheidend, um Nachteile zu minimieren und Chancen zu nutzen.